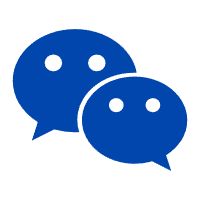Die Herausforderung der Künstlichen Intelligenz in Europa: Vertrauen der Forschenden gewinnen
#News ·2020-07-27 10:06:42
Experten sind sich einig, dass Künstliche Intelligenz (KI) europäischen Forschenden große Vorteile bringen könnte – doch es bestehen weiterhin viele Hürden, insbesondere mangelndes Vertrauen.
Bei einer Science|Business-Konferenz über die Vorteile von KI für europäische Forschung und Innovation erklärte Lucilla Sioli, Direktorin für Künstliche Intelligenz und digitale Industrie bei der Europäischen Kommission, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Europa KI nur zögerlich annehmen. Ein Grund dafür seien ethische Bedenken wie mangelnde Transparenz oder Voreingenommenheit von Algorithmen. Könnte ein auf klaren ethischen Prinzipien basierender Ansatz Europas Position stärken?
Zur Bewältigung dieser Herausforderungen gründete die Europäische Kommission im Juni letzten Jahres eine hochrangige Expertengruppe für KI (HLG), bestehend aus 52 Fachleuten aus Wissenschaft, Industrie und Zivilgesellschaft. Ihre Aufgabe: Prinzipien zu formulieren, denen Entwickler und Nutzer folgen sollten, um Vertrauen in KI zu schaffen. „Das Ziel ist es, das Denken der Entwickler zu verändern – sie sollen sich die richtigen Fragen stellen und konkrete Maßnahmen ergreifen“, so Sioli.
Loubna Bouarfa, Mitglied der HLG und CEO von Okra Technologies, glaubt, dass klare ethische Leitlinien die Zusammenarbeit zwischen Akteuren fördern und das Potenzial Europas freisetzen können. Okra entwickelt Technologien, die medizinischem Fachpersonal helfen, komplexe Datensätze zu integrieren und in Echtzeit evidenzbasierte Erkenntnisse zu gewinnen.
Davide Bacciu, Assistenzprofessor für Informatik an der Universität Pisa, betonte jedoch, dass das Festhalten am europäischen Modell einer ethik- und transparentenbasierten KI erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung in Europa haben könnte. „Natürlich könnte das den Handlungsspielraum einschränken oder unseren Fortschritt verlangsamen. Wir müssen wissen, welchen Weg wir einschlagen.“
Einigkeit besteht darüber, dass Forschende KI besser verstehen müssen – laut Bacciu erscheint sie vielen wie „schwarze Magie“. Erik Schultes, Vizepräsident bei Elsevier für Forschung und Anwendungen, meint, dass die Entmystifizierung der KI Europas Forschung und Innovation beschleunigen könnte.
Das Panel hob die Notwendigkeit hervor, Forschende zu schulen, damit sie das Potenzial der KI erkennen und sie kompetent in ihre Arbeit integrieren können. Die begrenzte Nutzung von KI sei auch auf die vergleichsweise schwache Recheninfrastruktur Europas zurückzuführen. Sioli betonte, Europa müsse in der aktuellen geopolitischen Lage technologische Souveränität und Eigenständigkeit erreichen.
Angesichts von über einer Million wissenschaftlicher Veröffentlichungen jährlich, einer wachsenden Datenflut und zunehmender Interdisziplinarität stehen Forschende unter Druck. Rose L’Huillier, Vizepräsidentin bei Elsevier, stellte zwei KI-Tools vor, die helfen sollen: eines bietet rasche wissenschaftliche Übersichten, das andere prognostiziert das Interesse der Nutzer an Artikeln – und reduziert so die Suchzeit erheblich.
Geleyn Meijer, Rektor der Hochschule Amsterdam, sieht einen Wandel: Wirtschaftswissenschaften würden zur „digitalen Wirtschaftsforschung“, Sozialwissenschaften zur „digitalen Sozialwissenschaft“. Doch wie schnell dieser Generationenwandel gelingt, sei unklar – manche Forschende seien noch nicht bereit, ihre Arbeit durch die Linse der KI zu betrachten. Er sprach von einer „Midlife-Krise“ Europas im Umgang mit KI.

 English
English  Deutsch
Deutsch 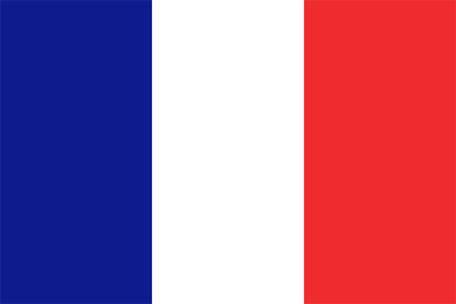 Français
Français  Español
Español 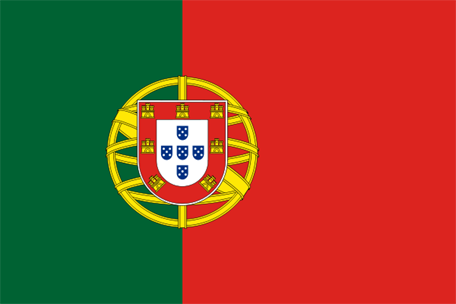 Português
Português  Italiano
Italiano  にほんご
にほんご  Nederlands
Nederlands